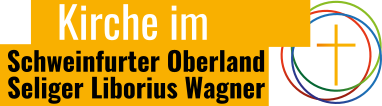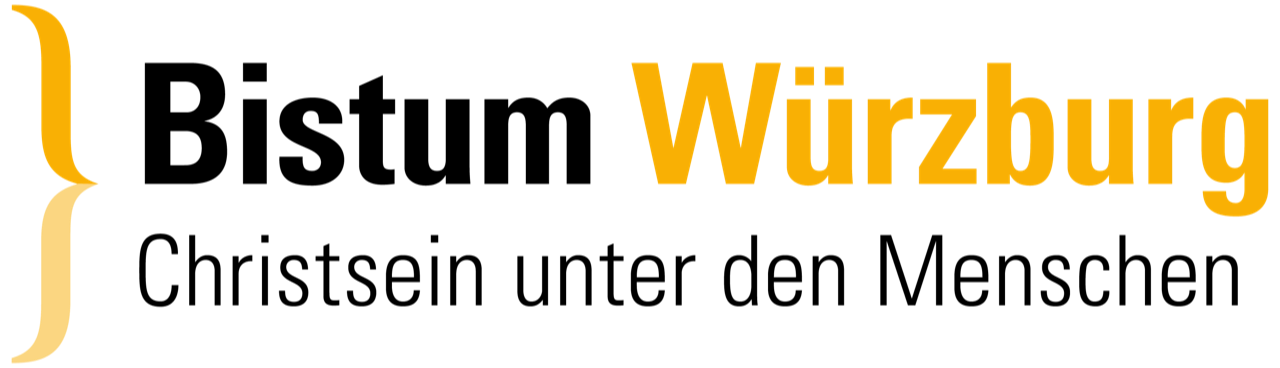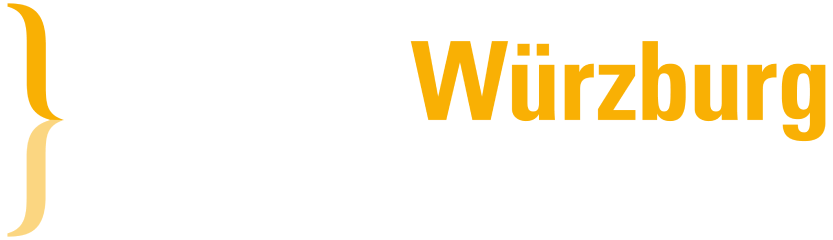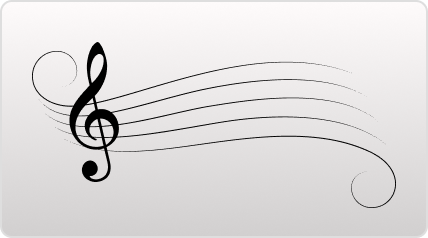Fest der Heiligen Familie: Mit Gottvertrauen einander tragen
Predigten 2025 / III
Kiliani: Sprachfähig
15. Sonntag im Jahreskreis: Glaube ist einfach
16. Sonntag im Jahreskreis: Gastgeber und Gäste
17. Sonntag im Jahreskreis: Herr, lehre uns beten!
18. Sonntag im Jahreskreis: Das Bleibende finden
Mariae Himmelfahrt: Von der Mutter die Sprache des Glaubens lernen
20. Sonntag im Jahreskreis: Herausforderungen lassen uns reifen
23. Sonntag im Jahreskreis: Glaube und Vernunft
Kreuzerhöhung: Zeichen der Erlösung
25. Sonntag im Jahreskreis: Großzügigkeit
Predigten 2025 / II
5. Fastensonntag: Wahrer Mensch und wahrer Gott
Palmsonntag: Kleine Zeichen der Hoffnung
Gründonnerstag: Wie stehst Du zum Herrn?
Karfreitag: Leben im Tod
Osternacht: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Ostersonntag: Christus lebt in uns
Ostermontag: Pilger der Hoffnung
Messe f. Papst Franziskus: Keiner rettet sich alleine
Weißer Sonntag: Unser Glaube ist gut begründet
3. Ostersonntag: "Simon, liebst du mich?"
4. Ostersonntag: Er hört uns und wir wollen auf ihn hören
5. Ostersonntag: Damit der Herr unter uns sichtbar bleibt
6. Ostersonntag: Gewissheit des Glaubens
7. Ostersonntag: "Vater, lass sie eins sein!"
Pingsten: Der Geist führt uns in die Familie Gottes
Pfingstmontag: Der Geist der Kindschaft
Dreifaltigkeitssonntag: Miteinander und Füreinander
Fronleichnam: Von IHM und füreinander leben
12. Sonntag im Jahreskreis: Schauen auf den Durchbohrten
Patrozinium "Geburt Johannes des Täufers": Mut zum Aufbruch
Petrus und Paulus: Was uns zu Christen macht
Predigten 2025 / I
Predigt von Pfarrer Daigeler zu Neujahr
Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Papst Franziskus hat in der Weihnachtsnacht im Petersdom die Heilige Pforte geöffnet. Normalerweise ist dieses Kirchenportal zugemauert. Nur in einem Heiligen Jahr wird diese Tür geöffnet. Symbolisch klopft der Papst an das Tor, dann durchschreitet er es als Erster von zahllosen Pilgern. Dieser äußerliche Vorgang versinnbildlicht einen inneren. Ein verschlossener Weg öffnet sich; ein Ausweg aus einer Sackgasse tut sich auf; ein neuer Anfang wird ermöglicht.
Nun begehen wir als Kirche 2025 ein Heiliges Jahr. Es fällt nicht ganz zusammen mit dem Beginn des Kalenderjahres, den wir heute begehen. Es hat bereits mit dem Weihnachtsfest begonnen, dessen Oktavtag wir heute feiern. Aber warum ist das so?
Die jüdische Philosophin Hanna Arendt (1906-1975) hat die Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts gesehen und vor allem die Abgründe, in die gottlosen Diktaturen den Menschen in Kriegen und Konzentrationslagern gebracht haben. Angesichts einer Welt in Trümmern schreibt die Philosophin: „Das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und von dem Verderben rettet, ist […] das Geborensein […]. Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten […]: ‚Uns ist ein Kind geboren‘“
Diese Hoffnungsbotschaft ist der Grund für das Heilige Jahr: „Fürchtet euch nicht, denn ein Kind ist uns geboren“! So haben es die Engel den Hirten verkündet. So bezeugen es Maria und Josef allen, die zur Krippe kommen. Das Heilige Jahr beginnt mit Weihnachten, weil Weihnachten das Fest des neuen Anfangs ist, den Gott selbst gemacht hat. Gott lässt uns Menschen nicht ins Leere laufen. Er hat den Ausweg aus allen Irrwegen und Sackgassen der Geschichte gezeigt, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, um uns der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Was könnte diese Frohe Botschaft deutlicher zeigen als die Geburt eines Kindes. Das Christuskind zeigt uns, dass Gott immer einen neuen Anfang schaffen kann und will. Das Heilige Jahr ruft uns diese Glaubensgewissheit in Erinnerung. Und damit sagt es zugleich: Christsein heißt auch, dass wir selbst immer wieder neu anfangen dürfen. Darum ist das Heilige Jahr eine besondere Einladung, Versöhnung zu wagen – zwischen Völkern und Gruppen, in der Familie, in meinem eigenen Leben, auch durch das Sakrament der Versöhnung.
Wo wir diese Botschaft ausstrahlen, werden wir Missionare sein. Denn wonach sehnt sich unsere Welt mehr als nach Hoffnung, als nach der Möglichkeit der Versöhnung und des Neuanfangs? Unser Heiliger Vater hat uns als Leitwort für dieses Jahr mitgegeben, „Pilger der Hoffnung“ zu sein. Das wäre ein guter Vorsatz für das neubegonnene Jahr: Wir wollen Pilger der Hoffnung sein! Wir wollen Menschen sein, die dem neuen Anfang vertrauen, den Gott selbst uns in seinem Sohn geschenkt hat, die Jesus nachfolgen, die Versöhnung wagen, die Hoffnung teilen.
Der Neujahrstag ist auch der Gottesmutter Maria geweiht. Sie möge uns die Mutter der Hoffnung sein. Sie zeigt uns immer ihr Kind und gibt uns als Rat: „Was er euch sagt, das tut.“ Amen.
01.01.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 2. Sonntag nach Weihnachten
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Gott lässt sich finden! Gott lässt sich finden, könnten wir als Überschrift über die biblischen Texte dieses zweiten Sonntags in der Weihnachtszeit schreiben. Wir schauen noch einmal aus einem anderen Blickwinkel auf das Geschehen im Stall von Betlehem. Im neugeborenen Jesuskind zeigt uns Gott sein Gesicht, damit wir ihm glauben. Er nennt uns seinen Namen, damit wir ihn ansprechen können.
Nun ist es aber mit dem Glauben nicht immer so einfach. Mancher sagt: Gott lässt sich finden? Ja, wo denn? Ich sehe ihn nicht. Ich kann ihn nicht begreifen, besonders wenn Menschen leiden müssen an Ungerechtigkeit oder Krankheit. Oder wie ist das mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften? Haben sie nicht den Glauben überflüssig gemacht?
Glauben zu können, ist gewiss ein Geschenk. Wir merken es ja etwa daran, dass die Kinder derselben Eltern, die eine gemeinsame, religiöse Erziehung erhalten, darauf unterschiedliche Antworten geben können. Den Glauben kann man nicht „erzeugen“. Ebenso wenig, wie ich einen Menschen zwingen kann mich zu lieben. Glauben heißt, staunen können. Glauben heißt, vertrauen können. Und Glauben heißt, sich binden können an Gott. Das ist ein Wagnis, das Mut erfordert.
Gleichzeitig gibt es gute Gründe zu glauben. Papst Benedikt wurde nicht müde daran zu erinnern, dass Glaube und Vernunft zusammengehören, dass sie rechtverstanden einander nicht widersprechen können. Das können wir sehen, wenn wir mit staunenden Augen die Schöpfung und ihre Ordnung betrachten. Alle Menschen können in ihr die Spuren des Schöpfers entdecken. Und doch waren diese Spuren für Gott zu wenig. Er wollte, dass wir seine „Weisheit“, also seinen Heilsplan begreifen. Darum verortete er seine Weisheit an einem konkreten sichtbaren Ort, nämlich im Volk Israel. So hörten wir es in der Ersten Lesung. An diesem Volk will er beispielhaft zeigen, wie er seine Nähe und Liebe erweist, wo sich Menschen für ihn öffnen. Ein Beispiel soll es sein für alle Völker.
Das Weihnachtsfest ruft uns zu: Das Wort ist Fleisch geworden. Gottes Sohn wurde geboren von einer Frau. Gottes Weisheit ist in Jesus sichtbar geworden. Der Apostel Paulus singt überschwänglich darüber in seinem Epheserbrief. Das, was Gott schon im Voraus, schon vor Beginn der Welt gewollt hat, ist nun greifbar geworden in Christus.
Daraus könnte man folgern, dass nun jeder zum Glauben kommen müsste. Aber doch war das zur Zeit Jesu nicht so, und ist auch heute nicht so. Den Evangelisten Johannes bewegt diese Frage: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“. Gott kommt uns entgegen, aber er kam nicht mit göttlicher Macht. Er liefert sich uns aus in der Schwäche eines Kindes und später am Kreuz. Gott kommt uns nahe, in dem was wir kennen, in dem was wir sind, in unserem Menschsein. Aber nicht jeder nimmt jemanden auf, der so armselig daherkommt.
„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden“, schreibt der heilige Johannes weiter. Gott wirbt um mich. Gott sehnt sich nach meiner Gegenliebe. Und das geschieht in Freiheit. Darum ist der Glaube eine Entscheidung, ein Akt des Willens. Gott lässt jedem Menschen die freie Entscheidung. Sie macht meinen Glauben zum Liebesgeschenk.
Das ist die Frohe Botschaft von Weihnachten: Gott lässt sich finden, dort wo ich meine Augen, mein Herz für ihn öffne. Er ruft mich auf zur Entscheidung, dass ich ihn aufnehme in mein Leben, dass ich ihm nachfolge. Wer das wagt, der findet die Freude, ein Kind Gottes zu sein. Amen.
05.01.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Hochfest der Erscheinung des Herrn
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Sternsinger, wenn wir die Weihnachtszeit feiern, könnte man den Eindruck bekommen, es handle sich um ein beschauliches Fest: Das Kind, Maria und Josef, die Hirten… Unsere deutsche Art Weihnachten zu feiern, fördert diese Innigkeit. Das ist nichts Schlechtes. Heute wird es aber erweitert durch das wichtige Fest der Erscheinung des Herrn. Im kirchlichen Kalender steht der Dreikönigstag in seinem Rang auf Augenhöhe mit dem Weihnachtfest.
Worum es geht, davon berichtet uns der Evangelist Matthäus. Sterndeuter kommen aus dem Osten, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Nicht nur die Menschen an einem Ort, nämlich Betlehem, sind eingeladen, nicht nur ein Volk, also Israel, ist angesprochen, nein, auch die „Heiden sind Miterben“, sagt der heilige Paulus. Alle Menschen der Erde sind eingeladen, zu Jesus zu finden. Diese Frohe Botschaft verkörpern die Weisen aus dem Morgenland. In ihnen wird die Völkerwallfahrt, von der Jesaja sang, Wirklichkeit. „Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz“, hörten wir in der Ersten Lesung.
Doch wir hören diese Texte nicht als bloße Erinnerung an vergangene Ereignisse. Das Wort der Heiligen Schrift will uns heute etwas sagen, es will uns heute in Bewegung bringen. Was können wir also von diesen Weisen aus dem Osten für unser Christsein und Kirchesein lernen?
Mir sind bei der Betrachtung des Schrifttextes drei Impulse aufgefallen. Der erste Impuls wäre: Aufmerksam Hinsehen. Die Sterndeuter beobachten die Gestirne und nehmen Veränderungen wahr und lernen daraus. Sie hören aber auch die Zwischentöne in den gerissenen Reden des König Herodes und gehen dann neue Wege. Sie sind also aufmerksame Menschen. Wie oft gehen wir achtlos durch das Leben. Sehen wir das Schöne, das uns Gott in seiner Schöpfung schenkt? Sehen wir den Nächsten mit seinen Nöten oder Fragen? Sehen wir, was vielleicht nicht mehr trägt in der Kirche, wo zwar noch der äußere „Palast“ steht, aber gar kein Glaube mehr da ist? Für unser Christsein braucht es den aufmerksamen und achtsamen Blick, es braucht aber auch den ehrlichen Blick.
Ein zweiter Impuls wäre das Aufbrechen. Die Weisen aus dem Osten nehmen einen weiten Weg auf sich, um zu dem neugeborenen König zu kommen. Unser Christsein wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern. Für die Begegnung mit Christus in den Sakramenten werden wir Wege auf uns nehmen müssen. So kostbar die Kirche im eigenen Ort ist, noch wichtiger als ein Gebäude ist die lebendige Feier des Glaubens, besonders in der Heiligen Messe. Unsere Brüder und Schwestern in der Diaspora zeigen uns, dass es möglich ist und sich lohnt, hierfür einen Weg auf sich zu nehmen. Der Evangelist berichtet uns nicht von der Freude eines bequemen Daheimbleibens, sondern von der Freude, das Kind und seine Mutter zu finden.
Schließlich hieße ein dritter Impuls, Gaben einbringen. So schön es ist, das Kind zu sehen. Das reicht nicht. Die Sterndeuter bringen ihm kostbare Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Kirche wird nur überleben, wo Menschen das Kostbarste einbringen: ihre Zeit, ihre Talente, ihre Kraft. Und das ist ganz konkret gemeint. Gestern haben Menschen am frühen Morgen Schnee geräumt, damit wir zur Kirche kommen können. Oder für die Feiertage haben Menschen unsere Gotteshäuser besonders geschmückt und geputzt. Oder heute gehen Kinder und Jugendliche als Sternsinger durch den Ort. Ohne solche Mitarbeit geht es nicht. Alle sind gebraucht, egal von wo sie kommen. Es reicht nicht Zuschauer zu sein, das Christuskind bittet um meine Talente und Gaben.
Erscheinung des Herrn ist ein wunderbares Fest. Es sagt uns, dass alle eingeladen sind zum Jesuskind zu kommen und ihm zu glauben – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Bildung oder Beruf… Die Sterndeuter geben uns mit ihrem Vorbild aber auch Impulse für unser Christsein mit: Aufmerksam und ehrlich hinzuschauen, Wege auf sich zu nehmen für die Begegnung mit dem Herrn und schließlich ganz konkret meine Gaben einzubringen, damit die Kirche Christi wachsen kann. Amen.
06.01.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Fest der Taufe des Herrn C
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, im vergangenen Sommer waren wir mit einer Pfarrei-Wallfahrt in Norwegen. Wer dort in die Sonntagsmesse geht, wird Norweger antreffen, aber in mindestens ebenso großer Zahl Menschen aus Polen, aus Vietnam, den Philippinen und anderen Ländern. Diese Erfahrung kann man in vielen, katholischen Kirchen weltweit machen. Das veranschaulicht uns gut, was der Apostel Petrus in seiner Predigt meinte, die wir in der Ersten Lesung gehört haben. In der Apostelgeschichte ist zu lesen: Jetzt begreife ich, dass Gott „in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist“.
Jede menschliche Gemeinschaft hat eine ausgesprochene oder unausgesprochene Definition, wer dazu gehört und wer nicht. Wir kennen Staatsbürgerschaften, Vereinsmitgliedschaften etc. Der Apostel Petrus spricht offensichtlich über die Zugehörigkeit zur Kirche Christi. Zur Kirche gehört man nicht durch die Geburt in einem bestimmten Volk, auch nicht durch den Wohnort oder die Abstammung von einer bestimmten Familie. Petrus sagt: Zur Kirche gehört, wer Gott fürchtet, was wir in der Sprache der Bibel mit Glauben gleichsetzen dürfen. Und als zweites Kriterium nennt er das rechte Tun. Was glaubst du? Und wie lebst du? Sind also die entscheidenden Fragen unserer Gemeinschaft.
Nach den weihnachtlichen Höhepunkten, dem Geburtsfest Christi und dem Fest der Erscheinung des Herrn, geht es heute um die Taufe Jesu. Wir haben es eben im Evangelium gehört: Jesus kommt an den Jordan und reiht sich ein in eine Gruppe unterschiedlicher Menschen. Doch, was sie alle verbindet, ist der Wunsch, ihr Leben neu auszurichten durch den Glauben. Sie wollen ihr Leben mit Gott gestalten und tun, was recht ist. Ausdruck dafür ist die Taufe, die Johannes spendet. Der Täufer Johannes weiß, dass Jesus selbst dieser „Neuausrichtung“ nicht bedarf. Jesus ist ganz auf den Vater ausgerichtet. Jesus tut ausschließlich das Gute. Und doch stellt er sich mitten unter die Taufkandidaten, um zu bekräftigen: Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr habt das Richtige erkannt. Ich unterstütze euch auf diesem Weg.
Wir sind fast alle als Kinder getauft worden. Das ist richtig und gut. So kann man von Kindesbeinen an in das Leben aus dem Glauben hineinwachsen. Freilich gerät manchmal aus dem Blick, dass die Taufe die Bekräftigung bzw. das Fundament einer Entscheidung ist. Ich muss mich entscheiden, Gott „zu fürchten“, also ihm ganz zu vertrauen, und das Rechte zu tun. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Der alte Ritus der Taufe brachte das bei der Begrüßung in knappen Worten zum Ausdruck. Der Täufling bzw. sein Pate wurde gefragt: „Was begehrst du von der Kirche Gottes?“ Und die Antwort war nicht „die Taufe“, sondern „den Glauben“. Wer um die Taufe bittet, der bittet um Bestärkung im Glauben, um das Mitglauben mit der kirchlichen Gemeinschaft. Der reiht sich, wie Jesus am Jordan, ein in eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben (neu) ausrichten wollen auf Gott.
Der Taufritus ging weiter mit der Frage: „Und was gewährt dir der Glaube?“ – „Das ewige Leben“ antwortete der Pate. Und damit war klar, hier geht es nicht allein um eine Familienfeier, nicht nur um die berechtigte Freude über die Geburt eines Kindes. Hier geht es um alles, nämlich um das ewige Leben.
In knappen Worten wurde dann dem Täufling mitgegeben, wie man diesen Weg findet, nämlich durch das „rechte Tun“, wie es der Apostel sagte. Oder noch deutlicher mit den Worten Jesu: „Willst du also zum Leben eingehen. So halte die Gebote: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen… und deinen Nächsten wie dich selbst.“
Mit dem Fest der Taufe Jesu bekräftigen wir die Überzeugung: In unserer Kirche ist jeder willkommen, ob jung, ob alt, ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß… Entscheidend ist, dass einer mit uns Gott fürchtet und sich täglich bemüht, das Rechte zu tun. Diesen Weg hat uns Jesus gezeigt, ja, er ist ihn uns selbst vorangegangen, damit wir ihm folgen und so das Leben finden. Amen.
12.01.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 2. Sonntag im Jahreskreis C
Jes 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, jetzt müsste ich eigentlich die Ehemänner zur Hilfe bei der Predigt holen. Sie könnten helfen, diesen wunderbaren Satz zu veranschaulichen: „Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich.“ Dieses Trostwort des Jesaja haben wir gerade in der Ersten Lesung gehört. Im Bild von Braut und Bräutigam beschreibt der Prophet die besondere Beziehung, die Gott seinem Volk Israel schenkt.
Freilich werden diese Worte in eine konkrete Situation hinein gesprochen. Zur „Verlassenen“ und „Verwüsteten“ ist die Stadt Jerusalem geworden. Viele Jahre war das Volk in der Verschleppung in Babylon. Die Stadt liegt in Trümmern. Und auch jetzt, wo das Volk in die Heimat zurückkehren durfte, sind nicht alle Probleme gelöst. Mühsam ist der Wiederaufbau, die täglichen Beschwerden und Herausforderungen des Alltags sind bestehen geblieben. Kein irdisches Paradies ist angebrochen.
Gottlob nicht in dieser Heftigkeit gibt es aber doch eine Ähnlichkeit zur Ehe. Bei aller Festlichkeit der Trauung und der Freude über die Braut bleiben in der Ehe die täglichen Herausforderungen, das Ringen um den Zusammenhalt und die Versöhnung, die Sorge um die Familie und die Kinder… Sagen wir es ehrlich, auch für aufrichtige und gläubige Menschen kann die Stunde kommen, da „der Wein ausgeht“, wie wir es im Evangelium hörten. Der Glaube nimmt uns da nicht einfach heraus.
Und doch schenkt uns der Glaube etwas unendlich Kostbares, was Jesus dem Brautpaar mit dieser kaum fassbaren Menge von 600 Litern Wein verdeutlicht. Der Glaube schließt eine unerschöpfliche Quelle auf: die Liebe Gottes. Auch wenn manches nicht so gelingt, wie wir es uns vornehmen. Auch wenn wir nicht alles erreichen, wofür wir arbeiten. Auch wenn manches im Leben in die Brüche geht. Sein Erbarmen ist nicht erschöpft. Seine Barmherzigkeit ist ohne Maß.
Ist das jetzt eine fromme Floskel? Nein! Die Gewissheit zu haben, dass ich unerschütterlich geliebt bin, ist unendlich kostbar – gerade in schweren Stunden. Die Gottesmutter weiß das, darum weist sie die Diener darauf hin: Jesus weiß, was zu tun ist. Er weiß, was ihr braucht. Und er gibt im Übermaß. Ganz konkret dürfen die Hochzeitsgäste in Kana das erleben. Aber auch uns sagt Maria: „Was er euch sagt, das tut.“ Vertraut dem Herrn, er verlässt euch nicht.
Es ist wichtig an diese Frohe Botschaft zu erinnern. Es ist aber ebenso wichtig, dass Menschen im Sakrament der Ehe diese Botschaft verkörpern. In der Liebe und Treue der Eheleute wird die noch größere Liebe und Treue Gottes ganz konkret sichtbar in unserer Welt. Was für ein kostbares Zeichen! Man könnte sagen, es ist ein noch größeres „Zeichen“ als das „erste Zeichen“, das Jesus in Kana wirkt, wenn Mann und Frau mit Gottes Hilfe in guten und bösen Tagen zusammenstehen.
Der heilige Paulus spricht im Korintherbrief von der gegenseitigen Ergänzungsbedürftigkeit. Unterschiedliche Begabungen und Charismen müssen eingebracht werden zum Aufbau einer christlichen Gemeinde, zum Aufbau einer christlichen Familie. Haben wir keine Angst, etwas zu verlieren wenn wir etwas von uns verschenken. Haben wir keine Angst, dass wir zu kurz kommen könnten, wenn wir die tägliche Treue leben – die Treue zu Gott und die Treue zueinander. Seine Liebe ist unermesslich, die er uns schenken will. „Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich.“ Amen.
19.01.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 3. Sonntag im Jahreskreis C
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, der Glaube macht das Herz weit. Er macht das Leben schön. Natürlich gibt es auch Verzerrungen oder Entstellungen des Glaubens. Aber wir selbst haben hoffentlich schon die Erfahrung gemacht, wie wir durch ein Wort des Glaubens gestärkt worden sind oder dass wir in einer schweren Stunde gestärkt wurden durch die Erfahrung der Nähe Gottes.
Ganz so erzählt es uns die Lesung aus dem Alten Testament. Niedergeschlagen ist das Volk Israel. Die Stadt liegt in Trümmern. Wie soll es weitergehen? Gibt es überhaupt Zukunft? Da hält der Priester Esra eine ergreifende Predigt. Und hier geht es nicht um rhetorische Tricks oder emotionale Beeinflussung. Esra spricht Gottes Wort aus. Und dieses Wort baut die Menschen auf. „Die Freude am Herrn ist eure Kraft“, das wird nicht nur gesagt, das erfahren die Menschen.
Papst Franziskus hat diesen Sonntag zum „Sonntag des Wortes Gottes“ erklärt. Er erinnert uns damit daran, worum es in der Kirche geht und gehen muss. Es geht nicht um private Vorlieben oder um eigene Ideen. Es geht um Gott, um seine Botschaft, um seine Gegenwart. Der frühere Papst Benedikt hat es einmal so auf den Punkt gebracht: „Wo Gott ist, da ist Zukunft!“
Es gibt sicher viele schöne Geschichten und gute Worte, aber sie sind – wie alles in der Welt – vergänglich. Gott ist größer. Er ist ewig. Und genau das bekennen wir, wenn wir seinem Wort den Vorrang vor unseren Worten und Erzählungen geben, wenn wir die Feier seiner Gegenwart in der Sonntagsmesse für unersetzbar halten.
Ja, die Freude an ihm ist unsere Kraft. Genau das erleben die Menschen auch in der Heimat Jesu, in Nazaret. Jesus liest in der Synagoge aus der Heiligen Schrift vor. Der Absatz, den er liest, erzählt von der Rettung, die Gott schenkt. Ein Gnadenjahr, eine Zeit der Heilung soll für die Menschen anbrechen, wenn sie Gott erkennen und auf ihn vertrauen. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er erzählt nicht nur von dieser Nachricht. Er verkörpert sie. „Das Wort ist Fleisch geworden.“ So haben wir es an Weihnachten wieder gehört. Der Evangelist Lukas, von dem wir in diesem Jahr besonders hören, drückt es so aus: „Heute hat sich das Schriftwort erfüllt.“
Durch Jesus wissen wir, dass Gott uns sieht, dass Gott mich kennt, dass er mich in den Blick nimmt, ja, dass er mich heilend berühren will. Darum ist es so schön, dass wir in der Heiligen Messe das Wort des Herrn hören, wenn aus der Schrift vorgelesen wird, und dem Herrn auch leibhaft begegnen im Sakrament, wenn wir die heilige Kommunion empfangen. Das Wort wird Fleisch. Hier berührt uns der Herr und will unsere Freude sein.
Der Apostel Paulus ergänzt in der Zweiten Lesung diesen Gedankengang. Das, was uns geschenkt wird, muss uns wandeln und prägen. Wir empfangen den Leib Christi, damit wir selbst sein Leib werden.
Die Kirche ist der sichtbare Leib Christi in der Welt. Sie soll seine Stimme sein. Sie soll Christus sichtbar und berührbar machen für die Menschen. Das geschieht durch konkrete Menschen, durch meine guten Werke. Der heilige Paulus zählt unterschiedliche Talente und Charismen auf. Wenn sie zusammenwirken und eingebracht werden, dann wächst der Leib Christi. Dabei ist nicht der eine wichtiger als der andere. Jeder wird gebraucht an seinem je eigenen Platz. Nur im Miteinander gelingt es. Deshalb ist die Einheit unter den Gläubigen unser aller Auftrag. Wir sind kein Verein, keine Interessenvereinigung, wir sind Gottes Volk. Wir sind seine Kirche. Das merkt man da daran, ob wir seinem Wort glauben, auf es hören und ihm folgen, ob wir Freude am Herrn haben. Amen.
26.01.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Fest der Darstellung des Herrn - Mariae Lichtmess
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wie nehmen wir die Welt wahr? Ist es so, dass wir uns einfach umschauen müssen, und dann ist alles klar? Reichen die Augen aus, sofern man nicht sehbehindert ist? Sehen wir, die wir hier versammelt sind, alle dasselbe?
Die erste Reaktion könnte sein: Ja, natürlich. Wie könnte man über das, was doch sichtbar ist, verschiedene „Ansichten“ haben? Aber beim weiteren Nachdenken wird klar: So einfach ist es offensichtlich nicht. Sonst gäbe es ja nicht so unterschiedliche Sichtweisen in unserer Welt. Denken wir an die aktuellen, teils heftigen politischen Debatten. Ganz offenkundig gehen die Sichtweisen hier stark auseinander – über das, was man überhaupt sieht, und darüber, wie man es einordnet.
Das heutige Fest am Ende der weihnachtlichen Zeit trägt das Licht in seinem alten Namen: „Lichtmess“. Auch wenn die Kerzenweihe vor allem Dankesopfer für das Geschenk des Lebens anknüpft, vom dem uns das Evangelium erzählt. So haben die Kerzen – gerade in der dunklen Jahreszeit – doch eindeutig mit Licht zu tun. Und Licht ist nun einmal unverzichtbar, damit unsere Augen überhaupt etwas sehen können. Sonst tappen wir nicht nur sprichwörtlich im Dunkeln.
Um die Ereignisse richtig einzuordnen, um mein Leben gut ordnen zu können, brauche ich Licht. Aber was für ein Licht ist das? Die weihnachtliche Zeit gibt uns hier einen wichtigen Hinweis. Wir glauben, dass Gott uns entgegen gekommen ist in seinem Sohn Jesus. Er wurde von Maria geboren und hat als Mensch gelebt, damit wir ihn besser verstehen. Der Prophet Maleachi drückte es in der Ersten Lesung so aus: Nicht mehr nur ein „Bote“ kommt, der über etwas redet, sondern „dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr“. Gott hat zu uns gesprochen. Es ist nicht mehr nur eine Ahnung von Gott. Nein, er selbst hat sich gezeigt. Er selbst ist in diese Welt gekommen. „Mit Fleisch und Blut“, wie es die Zweite Lesung aus dem Hebräerbrief unterstreicht. Gott ist mit seiner ganzen Gottheit als wirklicher Mensch in unsere Welt gekommen. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch!
Damit ist aber auch gesagt, dass beide Dimensionen unverzichtbar sind für das rechte Verstehen der Welt. Es braucht zum einen das Hinschauen mit unseren Sinnen, das Nachdenken mit unserem menschlichen Verstand. Dafür hat uns der Herrgott ja diese Fähigkeiten gegeben. Zum anderen braucht es aber auch sein göttliches Licht, um tiefer zu schauen, um nicht beim Vordergründigen stehen zu bleiben. Und dieses Licht wird uns durch den Glauben geschenkt, durch die Worte der Heiligen Schrift, durch das Glaubensbekenntnis der Kirche, durch die Gaben des Heiligen Geistes. Was wir sehen, wird also ernst genommen und dann im Licht des Glaubens gedeutet.
Das Fest Mariae Lichtmess verdeutlicht uns das am Beispiel von zwei Menschen am Ende ihres Lebenswegs, Simeon und Hanna. Ihre körperlichen Kräfte sind aufgezehrt. Menschlich betrachtet ist noch nur Ende und Tod zu sehen. Aber durch den Glauben wird ihnen Zukunft und Hoffnung geschenkt. Sie sehen das Jesuskind, das Maria und Josef in den Tempel bringen. Und Simeon spricht: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen.“ Er schaut nun in neuem Licht auf sein Leben, sogar auf seine Sterblichkeit. Im Licht des Glaubens sieht er, wer sich an Jesus hält, der findet selbst in der Schwachheit Kraft, selbst im Tod Leben.
Als Glaubende sind wir nicht naiv. Wir lassen das Licht Christi in unser Leben leuchten. Er will es hell machen. Er ist uns Orientierung und Kraft. Wer Christus nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Amen.
02.02.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 5. Sonntag im Jahreskreis C
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, einen Fischer, der nichts gefangen hat, zur Führungskraft bestellen? Würden Sie das machen? Derzeit bewerben sich im Wahlkampf zahlreiche Personen um Spitzenämter in unserem Staat. Keiner von ihnen würde wohl in seine Bewerbung schreiben: Ich kann es nicht… Warum erzählt uns also die Berufungsgeschichte der ersten Apostel zunächst von einer erfolglosen Aktion? „Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen“, sagt Petrus zu Jesus.
Klar und deutlich werden in der Heiligen Schrift die Begrenztheiten und Schwächen der Propheten und Apostel genannt. Es sind Menschen wie wir, keine Superhelden. Der Prophet Jesaja darf einen Blick in den Himmel werfen, er darf die Herrlichkeit Gottes sehen, doch er geht nicht davon aus, dass er als „frommer Mann“ das verdient habe. Nein, beschämt erkennt er seine Sünden. „Weh mir“, ruft er aus. Wie könnte ich bestehen vor dem allheiligen Gott? Ähnliche Worte hören wir von Petrus nach dem reichen Fischfang: „Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch.“
Offenkundig geht es in den biblischen Lesungen heute um das Thema Berufung. Dieses Wort wird heute unterschiedlich verwendet. Viele meinen, „Berufung“ ist es, den Beruf zu finden, der zu mir passt, der mir Freude macht, zu dem ich mich „berufen fühle“. Das ist legitim, aber im biblischen Sinne meint Berufung vor allem, das, wozu ich „gerufen werde“. Der Herr beruft die Jünger. Es ist seine Initiative. Und viele Berufungserzählungen im Alten Testament sprechen davon, dass die Propheten zunächst weglaufen vor der gestellten Aufgabe, wie sie ihr Unvermögen benennen oder dass sie die Berufung sogar manchmal als Last erfahren.
Das entscheidende Wort im Evangelium sagt Petrus: „Auf dein Wort hin“, weil du es sagst, Herr, werde ich die Netze auswerfen. Eine christliche Berufung wächst nicht, wo ich sage: „Ich bin der Beste für diese Aufgabe, nimm mich.“ Nein, ich kann es eben nicht. Freilich fallen mir gute Worte ein, aber den wirklichen Trost für die Trauernden hat nur der Auferstandene. Freilich kann ich erzählen, dass Gott uns nahe ist, aber die wirkliche Gegenwart kann uns nur der Herr im Sakrament schenken. Freilich kann ich es sagen, dass es wieder gut wird, aber die echte Versöhnung vermag uns nur Christus in der Beichte zu schenken. Und das kann kein Mensch, das kann nur ER.
Und doch ruft der Herr Menschen – damals wie heute. Die Stimme des Herrn fragt: „Wen sollen wir senden?“ – Jesaja antwortet schlicht: „Hier bin ich, sende mich.“ Das ist der Weg, den Gott gewählt hat, damit sein Wort zu den Menschen gelangt, damit seine Gegenwart gefeiert und verkündet wird: konkrete Menschen. Verkündigung braucht Verkörperung. Jesus ruft Menschen, die um ihre Schwachheit wissen – Menschen, die auf sein Wort hin handeln. Und je mehr sie ihm vertrauen, desto fruchtbarer wird ihr Wirken.
Unsere Zeit braucht Priester und geistliche Menschen. Ich kann jeden jungen Menschen nur ermutigen zu fragen, ob ihn der Herr ruft. Nur wo konkrete Menschen ihre Zeit und Kraft, ja ihr Leben zur Verfügung stellen, wird die Kirche Zukunft haben. Strukturen und Organisationsformen sind wichtig, aber bedeutungslos ohne glaubende Menschen.
Natürlich gibt es immer wieder Unsicherheit oder Debatten darüber, ob das denn wirklich ausreicht. In Korinth meinte man, besonders charismatisch begabte Menschen sollten die Gemeinde führen, Menschen, die in Zungen reden oder Vision haben… Aber der heilige Paulus verwirft das. Es ist nicht entscheidend, noch bedeutend. Der feste „Grund, auf dem ihr steht“, schreibt er, ist das Evangelium, das Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das zu verkünden, ist die Berufung aller Christen und besonders der Geistlichen. Denn „durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet“. Amen.
09.02.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 6. Sonntag im Jahreskreis C
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wie komme ich zu einem guten Ergebnis, wenn eine schwierige Entscheidung gefragt ist? Es gibt Fragen, da ist es ganz offenkundig, wie man handeln soll. Ein Mensch stürzt vor meinen Augen auf dem Gehweg. Wer wäre der Meinung, dass man nicht unmittelbar gerufen ist zu helfen? Oder fügen wir hinzu, welcher Mensch, der zumindest immer wieder sein Gewissen prüft, der nicht vollkommen durch Gleichgültigkeit abgestumpft ist.
Es gibt auch Fragen und Situationen, in denen es nicht so klar ist, was zu tun ist oder wie man sich entscheiden soll. Als Christen ist für uns naheliegend, zu fragen, welche Hilfe uns hier der Glaube bietet.
Weisung bietet uns die Heilige Schrift. Sie enthält beispielsweise die Zehn Gebote, die ganz grundsätzlich den Schutz des Lebens, des Eigentums, der Treue, der Rechte des anderen unterstreichen. Ebenso haben wir die Überlieferung der Kirche. Sie birgt den Erfahrungsschatz unzähliger Christgläubiger, die aus dem Glauben in bestimmten Situationen bereits Entscheidungen getroffen haben. So hat die Kirche bei vielen Fragen bereits gesehen, was sich bewährt oder eben nicht. Darum teilt sie diese Erfahrungen mit uns.
Das sind unverzichtbare, wertvolle Quellen. Und doch sind sie kein „Rezeptbuch“, so dass wir nur nachschlagen müssten und dann wäre alles klar. Wir sehen ja, dass es auch zwischen Gläubigen manchmal Debatten gibt, was nun gilt…
Wenn wir über die Lesungen dieses Sonntags nachdenken, dann werden wir hier auf eine wichtige Ergänzung hingewiesen: Der Glaube will uns vor allem eine Haltung vermitteln. Jesus hat uns kein Nachschlagewerk hinterlassen, das auf jede Einzelfrage eine Antwort bietet. Wo er gefragt wird, gibt es tatsächlich Weisungen. Grundsätzlich lehrt er eine Haltung, die aus dem vollkommenen Vertrauen in den himmlischen Vater wächst. Ganz wie es Jahrhunderte zuvor bereits der Prophet Jeremia sagte: „Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt.“
Der Glaube erinnert uns bei allen Entscheidungen zuerst einmal daran: Du weißt nicht alles. Du kannst allein nicht alles. Für das gute Leben, für das Gelingen des Zusammenlebens bist du auf den anderen angewiesen – auf andere Menschen und auf den Herrn.
Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Wenn wir uns umschauen, dann hören wir doch eher die „Predigt“: Du kannst selbst definieren, wer du bist. Du weißt am besten, was gut für dich ist. Denk an dich, damit du genug von diesem Leben abbekommst…
Wir dürfen dankbar sein für die Weisung und Orientierung, die uns der Glaube gibt – als Einzelne wie als Gemeinschaft. Denken wir an die Zehn Gebote, an das Beispiel der Liebe, das uns Jesus gegeben hat, an den Erfahrungsschatz, den die Kirche aus dem gelebten Glauben hat. Was für eine Hilfe für das gute Leben ist uns hier geschenkt! Und doch braucht es bei allem die Demut. Das Evangelium mahnt: Weh euch, ihr Reichen, ihr Satten, ihr, die ihr meint alles zu wissen und zu können. Auf dem Weg Jesu müssen wir Lernende bleiben, denn nur den Armen, denen, die vom Herrn alles erhoffen, ist das Reich Gottes verheißen. Amen.
16.02.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 7. Sonntag im Jahreskreis C
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, manchmal ist zu hören, die Kirche sei zu streng. Sie solle ihre Weisungen zu Ehe und Partnerschaft, zum Schutz des ungeborenen Lebens, aber auch zur Ordnung des Gottesdienstes nicht mehr so genau nehmen… Wenn ich ins heutige Evangelium schaue, dann sind die Forderungen aus dem Munde Jesu noch weit anspruchsvoller. Die Feinde lieben; denen Gutes tun, die mich hassen; großzügig zu sein, wo weder Dank noch Anerkennung zu erhoffen sind. Das ist wahrlich viel verlangt.
Wie schnell ärgern wir uns über unseren Nachbarn, weil seine Hecke zu hoch ist, weil er sich so oder so verhalten hat... Beispiele für Unversöhnlichkeit und Streit würden uns wohl allen einfallen – vielleicht sogar in unserem eigenen Herzen. Aber jemanden zu achten, der mir im wahrsten Sinne des Wortes nach dem Leben trachtet, so wie es uns die Erste Lesung von David und Saul erzählte, würden wir das? Könnte ich das?
Aber vielleicht ist dieser Ansatz zu steil. Die Zweite Lesung ist aus einem anderen Zusammenhang genommen. Im Korintherbrief setzt sich der heilige Paulus mit verschiedenen Gruppierungen in der Gemeinde auseinander. Offensichtlich ist die Einheit der Christengemeinde in der griechischen Stadt gefährdet. Einige beanspruchen besondere Fähigkeiten und Charismen für sich. An bestimmten Phänomenen wie Visionen oder Zungenrede machen sie fest, dass sie mehr verstanden hätten vom Glauben als die anderen und darum mehr zu sagen hätten in der Gemeinde. Paulus weist das teils deutlich zurück und mahnt zur Nüchternheit. „Zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische“, schreibt er.
Was ist hier gemeint? Der christliche Glaube setzt nicht im luftleeren Raum an. Adam, auf den Paulus verweist, steht ja für den Menschen, wie er nun einmal ist – mit seinen Stärken und Schwächen. Die Erlösung geht nicht an unserem Menschsein vorbei. Der Gottessohn ist wirklich Mensch geworden, hat unser schwaches Fleisch angenommen. Und wir erhoffen einmal die „Auferstehung des Fleisches“, also des ganzen Menschen.
Wenn also unser Menschsein ernstgenommen wird von Gott selbst, dann hat das auch Folgen für das, was wir vom Menschen moralisch oder ethisch verlangen können. Ultra posse nemo tenetur. Verpflichtend sein, kann nur Mögliches.
Das weiß auch der Herr. Aber die Feldrede, wie wir sie im Lukasevangelium finden, ist eine bewusste Herausforderung Jesu. Jesus zeigt uns die größere Liebe Gottes. Das soll uns Ansporn und Anspruch sein.
Als Christen haben wir eine sehr realistische Sicht vom Menschen. Wenn wir an die Erzählung von Adam und Eva denken, an ihr Bemühen und ihre Schwachheit, an ihr Gelingen und Scheitern… Und doch fordert uns der Glaube heraus, immer einen Schritt mehr zu gehen, mehr Liebe zu wagen. Gebt auch dort, wo ihr nichts dafür erhoffen könnt, denn auch wir erhoffen, dass Gott großzügig mit uns ist. „Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.“ Amen.
23.02.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 8. Sonntag im Jahreskreis C
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, durch die Krankheit des Heiligen Vaters beten zur Zeit viele Gläubige für ihn; manche denken auch darüber nach, was er uns gelehrt hat. Für mich ist in seinen Predigten besonders oft das Thema „Unterscheidung“ zu hören. „Discernimento“ sagt Papst Franziskus dann auf Italienisch, zu deutsch: Unterscheidung. Für die geistliche Tradition des Jesuiten, aus der der Papst stammt, ist das ein Kernanliegen. Der Gründer der Jesuiten, der heilige Ignatius von Loyola hat sich intensiv damit beschäftigt. Er wollte Gläubigen helfen bei der „Unterscheidung der Geister“ und ihnen damit zu einer guten Entscheidung verhelfen. Er hat dazu das entwickelt, was wir „Exerzitien“ nennen.
Klar ist, dass es ein anspruchsvolles Unterfangen ist. Viel einfacher ist es, irgendwelche Stimmungen „rauszuhauen“, wie wir das häufig gesellschaftlich und medial erleben. Differenzierung und Unterscheidung sind mühsame Prozesse. Die alttestamentliche Lesung verwendet dafür das Bild eines Siebes und auch das Bild eines Brennofens. So wird deutlich: Es ist anstrengend. Und wenn wir das Bild des Baumes, das Jesus im Evangelium verwendet, noch hinzufügen, dann sehen wir auch, dass es Zeit braucht. Die Frucht wächst nicht in einem Augenblick. Sie braucht den guten Boden, sie braucht Sonne und Regen, sie braucht Zeit…
Und gerade das scheint mir ein Hauptproblem unserer Epoche zu sein. Wir haben keine Zeit oder wir nehmen uns keine Zeit für die Unterscheidung. Nahezu jeder von uns hat ein Smartphone. Wie oft schauen wir darauf: Gibt es etwas Neues? In der Welt, in meinem Freundeskreis… Gewiss wäre es naiv zu meinen, wir könnten in einer Welt ohne Technik leben. Ich will das auch gar nicht. Aber wir können nie mithalten mit der Geschwindigkeit der Rechner. Der Computer liest und rechnet ungleich schneller als wir. Darum dürfen wir ihn nicht zum Maßstab machen, er muss ein Hilfsmittel bleiben.
Keiner von uns kann einfach „aussteigen“ aus der Welt. Ich weiß auch nicht, ob das gut wäre. Wir wollen als Christen ja keine Sekte sein, die den Stand einer einzelnen Epoche einfriert und daran festhält. Aber es ist dennoch eine Entscheidung: Wo nehme ich mir Zeit, Dinge zu bedenken, zu unterscheiden…?
Das tägliche Gebet, gerade auch der Tagesrückblick am Abend, will dazu eine wertvolle Hilfe sein. Der kurze Besuch vor dem Tabernakel, das Innehalten im Gotteshaus innerhalb meiner Aufgaben, ist eine Chance, aus der Hektik herauszukommen. Auch die Heilige Messe, natürlich am Sonntag, aber auch an den Werktagen, ist eine wunderbare Gelegenheit zur „Unterbrechung“.
Freilich wissen wir auch, dass Gott nur leise spricht. Denken wir an den Propheten Elija, der weder im Sturm noch im Erdbeben, sondern erst im leisen Säuseln Gottes Stimme hört. Für die gute Unterscheidung braucht es das Hinhören in der Stille. Es braucht die Zeit, die wir uns nehmen müssen, um nachzudenken, auf den Herrn zu hören und mit ihm zu reden.
Schließlich erinnert uns die Zweite Lesung noch an eine wichtige Wahrheit unseres Glaubens. Paulus schaut mit uns auf den Gekreuzigten, der zugleich der Auferstandene ist. Wenn wir bei unseren Entscheidungen auf Gott hören, dann lässt er uns immer auch die andere Seite sehen: Ja, das Kreuz ist da, hier und jetzt. Es ist oft schwer. Aber es gibt noch etwas anderes, eine Hoffnung, eine Auferstehung, die wir durch Christus kennen.
Darum nutzen wir Hilfen, die er uns schenkt: das Gebet, das Wort Gottes, die Gemeinschaft der Kirche, die Sakramente, damit wir gute Früchte bringen, damit wir „aus dem guten Schatz unseres Herzens das Gute hervorbringen“. Amen.
02.03.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 2. Fastensonntag C
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, und Abram „glaubte dem HERRN“. Das Vertrauen steht am Beginn der Erzählung von Abram – später Abraham – im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis. Wenn wir solche Worte hören, klingen sie vielleicht wie selbstverständlich für uns. Klar, die Patriarchen und Propheten sowie später die Apostel und die Heiligen, sie haben an Gott geglaubt. Wie sollte es auch anders sein, sonst wäre ihre Geschichte ja nicht aufgeschrieben worden…
Aber ist das wirklich so? Abram und alle, die nach ihm kamen, waren Menschen, wie wir es sind. Das Wagnis des Glaubens war für sie nicht kleiner als für uns. Der hochbetagte, kinderlose Abram soll auf Gottes Geheiß in ein fremdes Land ziehen und darauf vertrauen, dass er zahlreiche Nachkommen haben werde. Das ist nicht leicht zu glauben.
Interessanterweise bringt die Heilige Schrift ein Bild als Hilfe. Gott sagt zu Abram, dass er zum Himmel blicken und die Sterne zählen solle. In diesem Vorgang können wir Wichtiges erkennen: Zum einen das, was wir tatsächlich alle können. Wir können zum Himmel blicken und in der unermesslichen Zahl und Schönheit der Sterne erkennen wir: Es gibt Größeres als mein kleines Leben. Ich bin nicht das ganze Universum, wie es manche augenscheinlich von sich selbst meinen. Die Welt, das All, die Sterne – all das überragt mich und mein Wissen und Können. Ich kann sie nicht zählen.
Nun kann ich daraus unterschiedliche Schlüsse ziehen. Ich kann sagen: All das ist so groß, dass es letztlich unverständlich bleibt. Ich bin winzig und unbedeutend in dem Ganzen. Darum kann ich machen, was ich will. Es ist Zufall oder was auch immer… Diese Haltung ist weit verbreitet. Als Glaubende werben wir für eine andere Sicht. Wir sehen uns als „Nachkommen Abrahams“. Er ist uns Vater im Glauben. Er schaut zum Himmel und vertraut: Es gibt einen, der die Sterne gezählt hat, weil er sie geschaffen hat. Hinter all dem steht nicht blinder Zufall, hinter all dem steht die schöpferische Liebe Gottes, sein Wille und seine Weisheit.
Wer das glaubt, der sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Ganz wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Im Licht des Glaubens sieht die Welt ganz anders aus. Vieles, was zufällig erscheint, ist wohlgeordnet. Bei jedem Kreuzweg, und der wird Jesus auf dem Berg offen angekündigt, erkennen wir, auch das Leiden hat einen tieferen Sinn.
Aber das geht nicht ohne das Wagnis des Glaubens, ohne den „Sprung des Vertrauens“. Der heilige Paulus weint in der Zweiten Lesung über diejenigen, die nur am Leiblichen hängen, am Genuss, am Wohlergehen oder an der Gesundheit, und die keinen Blick für das Nicht-Sichtbare haben. Wie sehr ähnelt das einer Beschreibung unserer Zeit. Das Greifbare und das Sichtbare zieht uns mit aller Macht der Schwerkraft an. Darum fällt das Glauben vielen schwer.
Aber nur wer Gott Vertrauen schenkt, darf wie Abram in das Gelobte Land ziehen. Nur wer Glauben schenkt, kann die Schönheit von Gottes Verheißungen sehen. Uns ist nicht die Anziehungskraft des Sichtbaren gegeben. Aber uns sind Menschen des Glaubens geschenkt, wie Abraham, wie die unzähligen gläubigen Frauen und Männer vor uns. Und uns ist der Sohn geschenkt. Gott hat sich in Jesus gezeigt, damit wir ihm glauben.
Diese Erkenntnis ruft zur Antwort. Der Glaube ruft in den Bund mit Gott. Im Alten Testament wird der Bund sichtbar geschlossen mit einem Tieropfer. Im Neuen Testament ist der Bund durch Jesu Blut geschlossen. An uns ist es den Taufbund durch ein Leben aus dem Glauben zu realisieren, denn der Glaube braucht einen konkreten Ausdruck in meinem täglichen Leben. Hier findet er sichtbare Anziehungskraft, oder nicht. Darum ruft uns die Fastenzeit zu Gebet, Fasten und zum Teilen mit den Armen. Amen.
16.03.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 3. Fastensonntag (Lesungen vom Lesejahr A)
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, „verhärtet euer Herz nicht wie in Meríba, wie in der Wüste am Tag von Massa.“ Diese Worte aus dem Psalm 95 beten Priester und Ordensleute an jedem Morgen als Beginn des Stundengebetes. Wir haben diese Worte heute zwischen den beiden Lesungen als Antwortpsalm gehört. Nun kann man die Psalmworte als eine historische Erinnerung sehen an das, was wir in der Ersten Lesung gehört haben. Die Israeliten sind zwar aus Ägypten befreit, aber ihr langer Weg durch die Wüste macht sie müde. Sie sind erschöpft, sie sind durstig. Und da ist es doch nur verständlich, dass sie nach Wasser schreien.
Durst ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ohne Wasser verdursten wir, ohne Wasser kein Leben. Darum ist es normal, dass die Frau, von der wir im Evangelium hörten, Wasser schöpfen will. Ja, zugegeben, sie kommt zu einer ungewöhnlichen Zeit. In der Mittagshitze geht man in den heißen Ländern des Orients nicht aus dem Haus, so es nicht unbedingt nötig ist. Der Evangelist Johannes nennt aber auch den Grund: Die Frau möchte niemandem begegnen, nicht komisch angeschaut oder angesprochen werden, denn ihr Lebensstil ist anstößig.
Offenkundig hält das Jesus nicht ab, die Frau anzusprechen. „Gib mir zu trinken“, bittet er sie. Hier begegnet uns etwas sehr Wichtiges von der Art, wie Jesus handelt. Weder erklärt er zunächst der Frau, was sie beachten solle oder was in ihrem Leben falsch läuft. Nein, und darum ist die Frau auch so irritiert, Jesus fragt sie, was sie ihm geben kann.
Im Schulunterricht lerne ich immer etwas von den Kommunionkindern durch ihre Fragen. Ich hoffe freilich, dass die Kinder auch etwas von mir lernen. In der letzten Woche haben wir über das Wunder der Brotvermehrung gesprochen. Auch hier fragt Jesus zuerst seine Jünger, was sie zu geben haben. Und als sie geben, was sie haben – und mag das noch so wenig scheinen, bloß fünf Brote –, erst dann wirkt Jesus das Wunder. Die Frau am Jakobsbrunnen hat keine Brote. Der Evangelist erzählt uns nicht einmal, ob sie nun Jesus tatsächlich Wasser gegeben hat. Sie ist so erstaunt, dass Jesus überhaupt mit ihr spricht. Und doch gibt sie ihm etwas, ohne das er nichts bewirken könnte: Ihr Vertrauen.
Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet nicht euer Herz! Das ist die tägliche Bitte aus dem Psalm. Die Frau am Jakobsbrunnen zeigt uns, was das bedeutet und was es bewirken kann, wenn ein Mensch sein Herz nicht verhärtet, sondern öffnet.
Gar nicht wenige Menschen geben sich zufrieden, wenn ihr Durst gelöscht wird. Sie vermissen nichts ohne den Glauben, ohne die Kirche, auch nicht ohne Jesus. Es gibt zahlreiche Brunnen, aus denen sie schöpfen können. Darum ist es nicht einfach, die Herzen dieser Menschen zu erreichen. Nicht diese oder jene Strategie wird dabei helfen.
Den Schritt, das zu geben, was ich habe, kann mir keiner abnehmen – nicht einmal Jesus. Und doch oder vielleicht darum ist er uns längst entgegengekommen, wie wir im Römerbrief hörten. Gott hat seine Liebe schon verschenkt, als wir noch gottlos waren, als wir ihn noch gar nicht kannten. Der Glaube öffnet uns den Zugang zu eben dieser Liebe, sagt der heilige Paulus. Was für eine Hoffnung!
In jener Stadt kamen viele „zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin“, schreibt der Evangelist. Teilen auch wir unsere Hoffnung, damit viele ihre Herzen für Jesus, das lebendige Wasser, öffnen. Amen.
23.03.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 4. Fastensonntag (Texte Lesejahr A)
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, unmittelbar nach der Taufe wird dem Neugetauften bzw. seinen Eltern und Paten eine brennende Taufkerze überreicht. Dieses schöne Zeichen wird begleitet von einem Gebet: Der Getaufte möge „als Kind des Lichtes“ leben. Das Bild von den Kindern des Lichtes haben wir eben in der Zweiten Lesung gehört. Jesus sagt an anderer Stelle von sich: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben“. Der Glaube an Christus macht das Leben hell! Darum ist das Gebet wichtig, dass das Licht des Glaubens nie erlöschen möge in den Herzen der Getauften.
Das fürbittende Gebet ist wichtig, es wird allein aber nicht ausreichen. Jesus sagt ja auch, dass wir das Licht unseres Glaubens auf einen Leuchter stellen sollen, damit es allen leuchte, damit die Welt durch das Licht Christi hell werde. Am Ende der Fastenzeit, in deren Mitte wir heute stehen, werden wir in der heiligen Osternacht das Licht der Osterkerze in die Runde verteilen. Durch das Teilen des Lichtes wird es nicht weniger, sondern mehr. Der ganze Raum wird erhellt. Und dieser Vorgang verdeutlicht uns, wie die eigene Hoffnung wächst, indem wir sie mit anderen teilen.
Vermutlich sagt Jesus darum nicht nur: „Ich bin das Licht der Welt.“ Er sagt ebenso von allen, die an ihn glauben: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Was für eine Zusage! Ihr seid das Licht der Welt, weil ihr meine Jünger geworden seid, weil ihr – wie der geheilte Blinde im Evangelium – zum Glauben gekommen seid: Jesus ist der Sohn Gottes, der Heiland, der Erlöser!
Durch die Berührung mit Christus wird das Leben des Blindgeborenen hell. Etwas umständlich verdeutlicht uns das eine Zeichenhandlung im Evangelium. Jesus vermengt Speichel mit der Erde. Das soll ein Zeichen sein für das Wort, das aus Gottes Mund kommt und in die Welt gekommen ist. Es ist also ein Zeichen für Jesus selbst. Die Berührung mit ihm heilt. Sie macht das Leben hell. Darum ist es für uns so unverzichtbar sonntäglich zur Heiligen Messe zu kommen. In dieser Feier wird ja Christus für uns hörbar in seinem Wort und berührbar in der heiligen Kommunion.
Doch die Worte und Zeichen Jesus fordern auch Widerspruch heraus. Blinde werden sehend und Sehende blind. Die menschlichen Maßstäbe werden gesprengt. Das zeigt uns sehr schön die Erste Lesung. Die Salbung des kleinen Hirten David zum König macht deutlich: Gott selbst trifft die Wahl. Wie es Jesus sagen wird: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht weil ihr so originell oder stark etc. wärt. Sondern weil ihr zu mir gehört, weil ihr von meinem Licht entzündet seid. So ist der Glaube stets eine Entscheidung für Christus. Für das Leben nach seinen Maßstäben. Das kann mir Widerspruch einbringen.
Im Evangelium ist es nicht so, dass sich die anderen mit dem geheilten Blindgeborenen freuen. Sie hinterfragen, ob er überhaupt blind war, ob das stimmt und warum gerade er geheilt worden sein solle… Er wird ausgrenzt aus der örtlichen Synagogengemeinschaft und sogar aus seiner Familie. Christsein kann durchaus herausfordernd sein. Ich denke, Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass man dafür nicht nur Zuspruch erfährt. Und doch gibt es nichts Schöneres, weil uns die Freundschaft mit Christus Licht selbst in den dunkelsten Stunden, ja selbst im Tode schenkt. Damit wir uns darin einüben und uns gegenseitig stärken, sind wir in die Familie Gottes hineingetauft worden, in die Kirche. Lasst uns gemeinsam als „Kinder des Lichtes“ leben! Amen.
30.03.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigten von Pfarrer Daigeler 2024 / IV
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Fest der Heiligen Familie C
Sir 3,2-6.12-14; 1 Joh 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, auf den ersten Blick erscheint es wie das Normalste auf der Welt: Wenn wir Weihnachten feiern, dann muss man die Heilige Familie in den Blick nehmen. Schließlich berichten uns die Evangelisten auch von Maria und Josef, wenn sie von der Geburt Jesu in Betlehem erzählen. Dennoch kam dieses Fest erst von 100 Jahren in den kirchlichen Kalender. Für kirchliche Verhältnisse ist das relativ jung.
Man kann das jetzt für eine liturgiehistorische Randnotiz halten. Ich würde aber vor allem etwas darin sehen, was uns der Glaube schenkt. Das letzte Konzil sprach von einem Auftrag, die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen und sie „im Lichte des Evangeliums zu deuten“. Gott hat sich mitgeteilt in seinem Sohn. Alles, was er ist und hat, hat er den Menschen in Jesus gezeigt. Darum sind die Gelehrten im Tempel auch schon von dem zwölfjährigen Jesus beeindruckt. Es geht hier nicht um ein altkluges Kind, das bereits große Reden schwingt. Die Schriftkundigen erkennen, dieses Kind ist die Antwort auf all ihre Fragen. Das, was vorher bemerkenswert, aber irgendwie rätselhaft in den Worten der Schrift erschien, ist nun in ein neues Licht gestellt. Gott hat sich gezeigt in einer Weise, wie wir es verstehen können als wahrer Mensch, ohne dabei etwas von seinem Gottsein zu verlieren.
Natürlich ist unsere menschliche Aufnahmefähigkeit begrenzt. Wir können nur eine gewisse Zeit zuhören. Wir werden von bestimmten Themen mehr angesprochen, wenn sie einen Bezug zu meiner konkreten Lebenssituation haben. Und genauso geschieht durch die Jahrhunderte hindurch ein gläubiges Nach-Denken der Worte Jesu. Es kommt nichts Neues hinzu. Das kann nicht sein und es ist auch nicht notwendig. Aber es wird durch die „Zeichen der Zeit“, also durch eine konkrete Fragestellung, ein Aspekt in der Botschaft Jesu deutlicher, als es vorher war.
Und so ist es offenbar mit der Heiligen Familie. Gingen die Menschen über Jahrhunderte davon aus, dass Familie im wahrsten Sinne des Wortes das „Normalste“, ja das Natürlichste auf der Welt ist. Schließlich hat ja jeder Mensch eine Mutter, die ihn geboren hat, und jeder Mensch hat auch einen Vater, der hoffentlich Verantwortung übernimmt. Aber durch verschiedene Einflüsse wurde das erschüttert – zum einen durch wirtschaftliche Einflüsse, wie etwa durch die Taktung der Arbeit in der Industrialisierung, oder durch politische Einflüsse, wie etwa die sozialistische Idee, dass die „Volksgemeinschaft“ wichtiger sei als die individuelle Familie. Die Kirche nahm nun ihren Auftrag an, diese Zeichen der Zeit „im Licht des Evangeliums zu deuten“. Dabei half der Blick in die Heilige Schrift. Schon im Alten Testament gibt es Weisungen, wie „Ehre deinen Vater und deine Mutter“. Oder Jesus Sirach sprach in der Ersten Lesung davon, dass die Liebe, die man den Eltern erweist, großen Segen bringt. Ganz besonders deutlich wurde die Wahrheit über die Familie in der Menschwerdung des Gottessohnes.
In den Weihnachtsevangelien strahlt die Schönheit der Familie auf. Da wird nichts beschönigt. Maria und Josef müssen große Herausforderungen bestehen in ihrer jungen Ehe oder in der Sorge um die manchmal eigenen Wege der Kinder, wie eben gehört. Und doch vertraut Gott ihnen seinen einzigen Sohn an. Der Evangelist Lukas hält ausdrücklich fest, dass Jesus Maria und Josef „gehorsam“ war.
Wir feiern das Fest der Heiligen Familie. Wir bekennen damit die natürliche Wahrheit, dass es für Kinder – bei allen Herausforderungen – das Richtige und Gute ist, dass sie Vater und Mutter haben. Und wir werden in dieser Überzeugung bestärkt durch das übernatürliche Licht des Evangeliums, weil Jesus selbst in einer Familie gelebt hat. Möge das alle christlichen Familien ermutigen in ihrem Glauben, in ihrem Zusammenhalt. Amen.
29.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Stephanustag
Apg 6,8-10 u. 7,54-60; Mt 10,17-22
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wichtige Ereignisse klingen in unseren Herzen nach. Der kirchliche Kalender greift diese Wirklichkeit auf und feiert darum die wichtigsten Feste eine Oktav, also acht Tage, lang. Das Weihnachtsfest ist anrührend. Es ruft uns gleichzeitig die kostbare Wahrheit unseres Glaubens in Erinnerung: Gott ist Mensch geworden. Er selbst ist in seinem Sohn in unsere Welt gekommen, geboren von einer Frau. Er hat menschliche Sprache gesprochen, damit wir ihn verstehen. Er ist auf den Straßen des Heiligen Landes gewandelt, damit wir ihm nachgehen. Er hat unser Leben und sogar unser Sterben mit uns geteilt, damit wir ihm ganz vertrauen im Leben und im Sterben.
Diese Botschaft unterstreicht am heutigen Zweiten Weihnachtstag der heilige Stephanus mit seinem Blutzeugnis. Sein Mut rührt uns an. Er ist das, was allen Entstellungen zum trotz ein Märtyrer ist. Von seinem griechischen Ursprung her bedeutet das Wort „Märtyrer“ auf Deutsch „Zeuge“. Die frühe Christenheit griff dieses profane Wort auf und übertrug es auf den Bereich des Glaubens. Sie erinnerten sich an die Worte Jesu, die wir eben im Evangelium gehört haben. Er kündigte an, dass seine Jünger herausgefordert werden, Zeugnis zu geben – auch dort, wo es etwas kostet.
Noch einmal, das Weihnachtsfest sagt uns, dass Gott sich auf menschliche Weise gezeigt hat. Damit hat er aber auch den Weg festgelegt, wie seine Botschaft durch die Zeiten hindurch verkündet werden soll. Sie fällt nicht vom Himmel. Sie wird durch Menschen weitergegeben. Als Christen brauchen wir keine besonderen Fähigkeiten, Visionen oder geheimes Wissen. Uns ist die ganze Botschaft anvertraut vom Herrn selbst. Dafür ist er in die Welt gekommen. Und er ruft uns zu: „Ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde.“
Weihnachten erinnert uns daran, dass der christliche Glaube sich an alle Menschen richtet. Das Konzil sagte: Der Sohn Gottes „hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt“ (Gaudium et spes, 22). Diese Frohe Botschaft braucht Zeugen. Sie braucht Personen, die sie ausrichten: Eltern und Großeltern in der Familie, die den Kinder die Schönheit des Glaubens erschließen; Lehrer, Erzieher und Seelsorger, die uns die Tiefe und Wahrheit des Glaubens öffnen; Menschen, die durch ihren konsequenten Lebensstil, durch ihre Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe der Liebe Gottes trauen lassen. Ja, und es braucht auch Märtyrer wie Stephanus. Er ruft uns auch die Ernsthaftigkeit des Glaubens in Erinnerung. Die Märtyrer schrecken eine gleichgültige Welt auf. Aber in ihrer friedlichen Ganzhingabe sind die „Beweise“ des Glaubens, denn sie machen es für uns begreifbar, was es heißt, ganz auf den Herrn zu vertrauen, der für uns geboren wurde, der als unschuldiges Opferlamm freiwillig sein Blut vergossen, um uns das ewige Leben zu erwerben.
Ja, die Kirche braucht Zeugen der Wahrheit und des Friedens, Zeugen der Hoffnung wie den heiligen Stephanus, damit auch heute Menschen glauben, damit sie den Himmel geöffnet sehen. Amen.
26.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler am Weihnachtstag
Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wenn wir erklären wollen, was wir an Weihnachten feiern, dann werden viele vermutlich antworten: Wir feiern den Geburtstag Jesu. Das ist richtig, Weihnachten ist das Fest der Geburt Christi. Und doch geht es, wie man sich vielleicht denken kann, um etwas Umfassenderes.
Ein Kind kommt auf die Welt. Nach dem Bericht des Evangelisten Lukas geschieht das in Betlehem. Und seine Eltern Maria und Josef geben ihm dem Namen Jesus. Das hat ihnen ein Engel Gottes aufgetragen. Es ist wichtig, diese wunderbare Erzählung immer wieder zu hören. Sie geht uns zu Herzen und das soll sie auch. Freilich liegt in dieser Geschichte eine tiefere Frage und Sehnsucht des Menschen verborgen. Denn das Kind ist ein besonderes Kind. Empfangen durch das Wirken des Heiligen Geistes, wie wir es im Credo bekennen. Die Geburt des Jesuskindes gibt uns Antwort auf die Frage: Wie kann man Gott erkennen?
Im Menschen liegt ja eine Sehnsucht nach Sinn, nach Antworten auf die tiefere Bedeutung des eigenen Lebens. Kommen wir einfach auf die Welt und verschwinden dann wieder? Was soll all das Mühen und Anstrengen? Warum hat es mancher so schwer? … Seit Menschengedenken strecken wir aus nach dem, der diese Fragen beantworten kann, der die Grenzen unseres kleines Seins überschreitet, der Leben ohne Ende kennt.
Eine Ahnung davon hallt bereits in der ganzen Schöpfung wider. Der Evangelist Johannes beginnt sein Evangelium mit einem Prolog, der bewusst an die ersten Zeilen der Bibel erinnert. Im Buch Genesis ist die Rede davon, dass Gott alles geschaffen hat durch sein Wort, dass er eine gute Ordnung gegeben hat, in der sich der Mensch entfalten kann. Johannes greift das auf und meditiert mit uns über dieses „Wort Gottes“, das schon von Anfang an da war, durch das alles erschaffen wurde, ohne das nichts im Dasein ist.
Doch wie kommt er zu dieser Erkenntnis? Nun, wer aufmerksam auf das Leben schaut, der wird so etwas wie „natürliche Sakramente“ entdecken. Was meine ich damit? Es gibt Ereignisse, die vermitteln dem Menschen eine Ahnung von etwas, das mich übersteigt, und damit bereits eine Ahnung von Gott. Denken wir an die einschneidenden Ereignisse von Geburt oder Tod. Jeder merkt, das Leben ist nicht mein Produkt. Ich habe es nicht in der Hand. Es ist größer als mein Vermögen und Können. Ähnliches gibt es aber auch im Kleinen. Denken wir an eine Mahlzeit. Ich kann das nur als Nahrungsaufnahme sehen. Aber, wenn das in froher Gemeinschaft wie jetzt an den Feiertagen geschieht, erleben wir: Das, was mir hier geschenkt wird an Freude, an Erfüllung, das kann ich nicht einfach erzeugen. Es übersteigt die „Zutaten“, die wir bereit stellen.
Das sind Erfahrungen, die grundsätzlich allen Menschen zugänglich sind, so sie ihr Herzen nicht vollkommen davor verschließen. Nun gehen wir mit dem Inhalt des Weihnachtsfestes noch einen bedeutsamen Schritt weiter. Wir feiern, dass Gott selbst Mensch geworden. Wie es das Evangelium sagt: „Das Wort ist Fleisch geworden.“ Durch Weihnachten wissen wir: Gott ist kein Unbekannter mehr. Gott hat sich gezeigt in seinem Sohn. Jesus „hat Kunde gebracht“. Er hat uns unüberbietbar gezeigt, wer Gott ist und wie Gott ist – durch seine Worte, seine Taten und vor allem durch seinen Tod und seine Auferstehung. All das ist für uns aufgehoben in den christlichen Sakramenten. Hier ist der menschgewordene Gottessohn für uns berührbar. Er ist kein Fremder mehr. Wir tappen nicht mehr im Dunkeln. „Das Volk, das im Finstern lebt, hat ein helles Licht gesehen“, sagt der Prophet Jesaja.
Heute hat Gott „zu uns gesprochen durch den Sohn“, hörten wir eben aus dem Hebräerbrief. Diese Glaubensgewissheit liegt in der Geburt Christi verborgen. Sie zu entdecken, feiern wir Weihnachten. Hoffen wir, dass wir auf diesem Pilgerweg der Hoffnung voranschreiten. Beten wir heute, dass alle Menschen, dass „alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen“. Amen.
25.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler in der Heiligen Nacht
Jes 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, was hat es gebracht? Was hat die Geburt Jesu verändert? Warum lohnt es sich überhaupt Weihnachten zu feiern?
Gar nicht wenige Menschen verbinden mit Weihnachten den Wunsch nach Frieden – in der Familie oder auf der Welt. So heißt es zum Beispiel im amerikanischen Schlager „Someday at Christmas“, dass irgendwann an Weihnachten alle Menschen frei wären, es keinen Krieg mehr gäbe und alle Wünsche in Erfüllung gingen… Nun man darf gewiss ein solches Lied nicht überbewerten. Aber ich frage mich, ist es überhaupt das, was wir als Christen an Weihnachten feiern? Oder anders gefragt, was ist eigentlich die Botschaft, die uns dieses Festes mitteilen will?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Sache gewissermaßen von hinten aufrollen. Wir lesen das Evangelium meist als chronologischen Ablauf von der Geburt Jesu in Betlehem, über sein Heranwachsen in Nazareth, über seine Predigten und Wunder bis zur Kreuzigung in Jerusalem und seiner Auferstehung. So ist ja auch unser Glaubensbekenntnis aufgebaut. Das hat gute Gründe. Und doch war es historisch so, dass die frühen Christen erst im Blick zurück Jesus wirklich verstanden haben. Sie haben verstanden, wer Jesus in Wahrheit ist: wahrer Gott und wahrer Mensch. Weil er von den Toten auferstanden ist, wussten die Jünger: Er ist Gott. Weil er geboren wurde von einer Frau, wussten die Jünger: Er ist Mensch, wie wir.
Beides gehört zusammen. An Gott zu glauben, heißt nicht, an Märchen zu glauben oder daran, „dass alle Wünsche in Erfüllung gehen“. Ein solcher Glaube würde von manch bitterer Wirklichkeit schnell überführt. Jesus hat uns vielmehr gezeigt, wer Gott ist und wie er ist. Und das sehen wir in dieser Heiligen Nacht. Die Evangelisten erzählen davon, dass die Geburt Jesu äußerlich nichts verändert in der Welt. Augustus war weiter Herrscher des Reiches, arme Leute wie Maria und Josef mussten weiterhin nach einer Herberge suchen, bequeme Menschen liegen weiter im Bett in Betlehem und interessieren sich nicht für das Geschehen…
Äußerlich läuft die Welt bis heute weiter. Weiter gibt es Armut, Krankheit, Leid, Krieg… Und doch verändert die Geburt Jesu alles. Nun ist Gott sichtbar. Alle Menschen können ihn erkennen. Wir können ihn finden. Wir sind eingeladen, zu seiner Familie zu werden. Doch wie soll das gehen?
Es beginnt bei mir selbst. Ich bin gerufen, Jesus zum Herrn und Herrscher meines Lebens zu machen, damit nicht mehr die Herrscher und Süchte dieser Welt über mich bestimmen. Ich darf ihm meine Armut und Schwachheit bringen, damit er mich mit seiner Liebe beschenkt und so reich macht. Ich muss aus meiner Bequemlichkeit aufbrechen und ihm nachfolgen. So verändert sich die Welt – durch viele Menschen, die an unzähligen Orten kleine Schritte in den Spuren Jesu gehen.
Wir feiern Weihnachten und sind angerührt von dem Kind in der Krippe. Wir sehen Maria und Josef im Stall von Betlehem. Gott ist in unsere Welt gekommen, um sie von innen heraus zu verändern. Nicht durch eine Sensation, nicht durch Magie oder eine Maschine, die alle Probleme löst, sondern indem er alles mit uns teilen wollte, indem er uns das rechte Menschsein lehren wollte durch seinen eigenen Sohn. Darum kam das Jesuskind in Armut und Ohnmacht auf die Welt. „Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.“ Amen.
24.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 4. Adventssonntag C
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Advents- und Weihnachtszeit ist vor allem geprägt von Texten aus dem Lukas- und dem Matthäusevangelium. Diese beiden Evangelisten berichten uns über die Kindheit Jesu, was Markus und Johannes nicht tun. Die Bibel erzählt uns von sehr unterschiedlichen Reaktionen auf die Ankunft Jesu.
So ist Josef zunächst verunsichert über die Schwangerschaft seiner Braut Maria und doch vertraut er auf Gottes Wege. Zacharias diskutiert mit dem Engel, der ihm die Geburt seines Sohnes Johannes ankündigt. Und das führt dazu, dass er verstummt, um in der Stille nachzudenken und letztlich Gottes Weisung zu folgen. Es gibt aber auch Ablehnung, sei es durch Gleichgültigkeit wie bei den Menschen in Betlehem, sei es durch Neid bei König Herodes, der in seiner Verblendung dem Jesuskind sogar nach dem Leben trachtet.
Umso schöner ist es, dass wir an diesem Vierten Advent Maria und ihre Verwandte Elisabeth sehen. Die beiden Frauen hatten es nicht leichter als die anderen, Gott zu vertrauen, doch sie glaubten. Sie sagen mit ganzem Herzen „Ja“: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn“. So werden sie zu Mitarbeiterinnen des Erlösungswerkes. Die Frauen gehören unterschiedlichen Generationen an, Maria eine junge Frau, Elisabeth in „vorgerücktem Alter“. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich auf Gottes Ruf einlassen. Und wo ein Mensch bei Gottes Plan „mitmacht“, dort wird das Leben gut. Dort breitet sich Freude aus.
Diese Freude teilen die beiden Frauen. Es gehört zum Geheimnis der Freude, dass sie wächst, wenn man sie teilt. Das hat sie mit dem Glauben gemeinsam. Wir werden mit dem kommenden Weihnachtsfest ein Heiliges Jahr beginnen. Nach altem Brauch öffnet der Papst die Heilige Pforte in Rom. Natürlich geht es nicht allein um diesen Vorgang. Es geht um die Gnade der Erneuerung. Zunächst einmal geht es darum, meinen Glauben zu erneuern. Fragen wir uns, mit welcher Haltung begegne ich der Ankunft des Erlösers? Freudig, gleichgültig, skeptisch…? Jesus allein ist unser Erlöser, wie es die Zweite Lesung aus dem Hebräerbrief unterstreicht. Er hat seinen Leib, sich selbst hingegeben, um uns die Tür zum Leben aufzuschließen. Sein Tod, sein Opfer ist die eigentliche „Heilige Pforte“ zum Leben in Fülle.
Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn er in unseren Herzen wohnt, dann ergibt sich daraus ein weiterer Schritt, den uns Maria im Evangelium zeigt. Sie trägt das Jesuskind unter ihrem Herzen zu ihrer Verwandten. Jesus ist das Wertvollste, das wir als Kirche zu bringen haben. Ich bete dafür, dass das Heilige Jahr uns zu missionarischen Christen macht. Wir dürfen die Freude des Evangeliums mit anderen teilen. Wo das geschieht, dort hat der Glaube Zukunft.
Der Heilige Vater ruft eindringlich auf, dass wir im Heiligen Jahr dabei besonders die Kranken, die Armen, die Einsamen und Gefangenen, aber auch die Jugendlichen mit ihren Sorgen in den Blick nehmen. Papst Franziskus schreibt: „Das kommende Heilige Jahr wird also von der Hoffnung geprägt sein, die nicht schwindet, der Hoffnung auf Gott. ... Möge unser gläubiges Zeugnis in der Welt ein Sauerteig echter Hoffnung sein, die Verkündigung eines neuen Himmels und einer neuen Erde (vgl. 2 Petr 3,13), in der wir in Gerechtigkeit und Eintracht zwischen den Völkern leben können und die Erfüllung der Verheißung des Herrn erwarten.“
22.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 3. Adventssonntag C
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, „Tochter Zion, freue dich“, dieses Lied singen viele Christen in der Advents- und Weihnachtszeit. Es greift ein Wort des Propheten Sacharja auf, das in ähnlichen Worten auch die Botschaft des Propheten Zefanja in der Ersten Lesung war. Zion ist einer der Berge, auf dem Jerusalem erbaut ist. Das Heilige Land kennt nicht erst in der jüngeren Zeit ein Auf und Ab von Krieg und Frieden. Wer in das Alte Testament schaut, entdeckt, wie oft das Volk Israel besiegt oder gar vertrieben wurde.
Nun mag man sich wundern, weshalb dann hier von Freude die Rede ist. Bestenfalls könnte man doch von Trost sprechen, wie wir es in der Adventszeit auch hören aus dem Mund des Propheten Jesaja: „Tröstet mein Volk.“ Aber Freude und Jubel? Das ist doch ein wenig viel verlangt. Dennoch ist es unmissverständlich. Auch der heilige Paulus bekräftigt: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!“ Dieses Wort aus dem Philipperbrief hat sogar dem Dritten Adventssonntag einen Beinamen gegeben: Gaudete – Freut euch!
Aber holen wir das ein? Der religionskritische Philosoph Friedrich Nietzsche ächzte: „Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.“ Freilich ist Kritik immer einfacher als ein konstruktiver Beitrag. Aber dennoch können wir das nicht ganz vom Tisch wischen. An wem sollte denn die Welt die Frohe Botschaft ablesen, wenn nicht an uns, an unserem Leben, am Zeugnis derer, die Jesus nachfolgen?
Dass es hier nicht um andauernde „Partylaune“ gehen kann, liegt auf der Hand. Der durchaus deutlich sprechende Johannes der Täufer zieht viele Menschen an. So bezeugt es uns das Evangelium. Johannes strahlt etwas aus, das die „Erwartung“ im Volk nährt. Man hört ihm zu, man fragt ihn um Rat, ja man vermutet sogar, dass er selbst der Messias sein könnte. Lässt sich das auch über uns sagen?
„Was sollen wir also tun?“, fragen wir mit den Menschen am Jordan. Ich würde sagen, dass es im Kern um nichts Kompliziertes geht. Das kann es auch, da es für alle Menschen möglich sein muss, richtet sich doch die Frohe Botschaft an alle Menschen und zu allen Zeiten. Der Rat, den uns der Täufer Johannes gibt, ist Rechtschaffenheit. Er stellt nicht dieses oder jenes Konzept auf. Er sagt schlicht: Teilt miteinander, besonders mit denen, die in Not sind. Bleibt bei der Wahrheit und Ehrlichkeit. Meidet jede Form von Gewalt, ob in der Sprache oder in Taten. Oder wie es der Apostel Paulus zusammenfasst: „Eure Güte werde allen Menschen bekannt.“
Doch geht das überhaupt? Wo bleibe da ich und mein Vorteil? Wie kann Paulus sagen: „Sorgt euch um nichts“. Ist das nicht weltfremd? Damit das gelingt, braucht es die Gewissheit des Glaubens: „Der Herr ist nahe.“ Ja, damit wir mit Freude Gutes tun können, braucht es das Geschenk, das der Tochter Zion gemacht wird: „Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte“.
Es ist die besondere Berufung, die Gott dem Volk Israel anvertraut, dass es in allen Höhen und Tiefen die Gewissheit ausstrahlen soll: Wir sind Gottes Volk. Er vergisst sein Eigentum nicht. Er hört und sieht unser Gelingen und Scheitern. Und eben diese Berufung hat Christus ausgeweitet auf alle, die ihm glauben, die er „mit Feuer und Heiligen Geist“ getauft hat. Ja, wir Christen müssen erlöst aussehen. Nicht mit einem weltfremden Grinsen oder naiven Floskeln, aber mit der Tiefe einer unerschütterlichen Hoffnung: „Der HERR ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu fürchten.“ Selbst Johannes schreckt zunächst vor der Größe dieser Frohen Botschaft zurück und doch setzt er alles dafür ein. Und das merken seine Zuhörer. Amen.
15.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum 2. Adventssonntag C
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, am Heiligen Abend werden wir in der Einleitung des Evangeliums hören, dass zu „jener Zeit“ Kaiser Augustus seine Untertanen zählen wollte und Quirinius Statthalter von Syrien war. Auch im nächsten Kapitel seines Evangeliums, das wir gerade gehört haben, vermerkt Lukas, als er vom Auftreten des inzwischen erwachsenen Johannes berichtet, die Herrscher der Zeit, nämlich Kaiser Tiberius, Statthalter Pontius Pilatus und die Vasallen-Herzöge Herodes und Co. Natürlich hält der heilige Lukas all diese Personen fest, um zu unterstreichen: Hier – in Betlehem und später am Jordanufer – wird Weltgeschichte geschrieben. Aber es ist auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert für uns.
Im fernen Rom wird man keine Notiz genommen haben von dem Kind, das da in Betlehem geboren wurde, und auch nicht vom Täufer Johannes. Dennoch ist in diesem Unscheinbaren bereits die Kraft und Fülle der Frohen Botschaft vorhanden: „Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.“
Es ist ganz so, wie wir es in der Ersten Lesung hörten. Der Prophet Baruch spricht zum Volk Israel, das als Minderheit in der Fremde leben muss: „Leg dein Trauerkleid ab und steig auf den Berg“. Und schau, wie alle Völker sich auf den Weg zu dir machen, um von dir zu lernen, wer Gott in Wahrheit ist. Kein Hindernis soll zu groß sein, heißt es, kein Berg zu hoch, kein Tal zu niedrig. Keine Macht der Welt vermag diese Frohe Botschaft aufzuhalten: „Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis“ zeigen.
Der Evangelist sieht diese Verheißung in den Worten und Taten des Johannes erfüllt. Ja, Gott hat sich als treu erwiesen. Gott hält seine Versprechen. Gott sieht die Not seiner Gläubigen. Und doch, wie soll man das glauben? Kommen wir Gläubigen uns nicht manchmal als eine kleine Schar vor? Als Minderheit in der Fremde?
Heute wird nach nur fünf Jahren Bauzeit die Kathedrale Notre Dame in Paris wieder geweiht. Dieses historische Gebäude zeugt davon, wie sehr der christliche Glaube Europa geprägt hat, wie er die Menschen angespornt hat, ihre besten Fähigkeiten zur Ehre Gottes einzusetzen als Baumeister, Künstler, Kirchenmusiker etc. Auch nicht-glaubende Menschen waren erschüttert über den Verlust dieser Kathedrale. Es geht nicht nur um Kunst, es geht darum: Was fehlt, wenn das Gotteshaus aus unserer Mitte gerissen wird. Was fehlt, wenn die Menschen in unserem Ort es nicht mehr schaffen, die Kirche zu pflegen und zu erhalten? Ja, mehr noch, was fehlt, wenn Gott aus den Seelen der Menschen verschwindet? Es bleiben nur mehr Außenmauern einer zerstörten Ruine. Und es reicht nicht – so bewundernswert die Leistung in Paris ist – das Gebäude wieder mit Steinen in Stand zu setzen.
Als Notre Dame brannte, haben mich die jungen Menschen beeindruckt, die singend und betend auf der Straße verharrten und das „Ave Maria“ sangen. Ihr Beten ist für mich ein Zeichen der Hoffnung – der Hoffnung, dass Gott nicht verschwunden ist aus unserer Mitte. Wie schreibt es der heilige Paulus an die Philipper: „Ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium“.
Kein Denkmalschutz wird unsere Kirchen retten. Das können nur die Beter, die sie zu „Gotteshäusern“ machen, und die Menschen, die sich sorgen um die Sauberkeit und den Unterhalt. Vermutlich werden wir in Zukunft manchmal einen Weg auf uns nehmen müssen, um gemeinsam die Heilige Messe zu feiern. Doch unser Glaube ist nicht bequem. Johannes der Täufer ruft auf, die Komfort-Zone zu verlassen: „Bereitet dem Herrn den Weg!“, sagt er.
Zu diesem Dienst sind auch wir berufen als Christen. Ob wir viele oder wenige sind, wir wissen, der Herr ist in unserer Mitte. Er ist unsere Stärke. Was für eine Hoffnungsbotschaft hören wir an diesem Zweiten Advent! Helfen wir mit, dass sie zu vielen Menschen gelangt, dann wird in unserer Kirche „das Licht seiner Herrlichkeit“ erfahrbar. Amen.
08.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Ersten Adventssonntag C
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, mit diesem Sonntag beginnen wir die Adventszeit. Das Wort „Advent“ wird seltener verwendet. Was bedeutet „Advent“? Man kann das Wort wörtlich übersetzen. Dann heißt das ursprünglich lateinische Wort auf Deutsch „Ankunft“. So weit so gut, aber wer soll da ankommen? Oder wo soll jemand ankommen?
Üblicherweise hilft uns Christen ein Blick in die Heilige Schrift, wenn wir Antworten auf die Fragen unseres Glaubens suchen. Nun ist das heutige Evangelium ein besonders schwieriger Text. Bevor wir uns damit befassen, will ich zuerst beim bekannteren Inhalt des Advent ansetzen. Für uns Christen geht es um Maria und Josef, die ein Kind erwarten. So einfach und herausfordernd zugleich. Ein junges Paar erwartet ein Kind. Das ist ein so menschliches Bild, das es jeder versteht – weltweit und in allen Kulturen. Nun ist diese Erwartung aber weit größer und darum ist sie auch herausfordernder. Denn dieses Kind kommt von Gott. Der Engel Gabriel hat es Maria verkündet. Und sie hat dieses Geschenk Gottes angenommen. Gott selbst will in die Welt kommen. Er kommt auf menschliche Weise, damit alle es verstehen, damit alle Menschen erkennen, dass sie angesprochen sind. Gottes Sohn kommt in die Welt, damit alle Menschen den Weg zu Gott finden – in diesem Leben durch den Glauben und einmal im ewigen Leben.
Das ist wohl der bekannteste Inhalt des Advent und des kommenden Weihnachtsfestes. Aber wir wollen doch in das Evangelium schauen. Jesus spricht hier vom Ende der Welt. Soll uns das Angst machen? Unweigerlich fürchten wir uns davor, dass die Sicherheiten unserer Welt zusammenbrechen oder dass mein Leben einmal zu Ende geht. Umso wertvoller ist diese weniger bekannte Seite des Advent. Denn der Advent erinnert uns auch daran, dass wir uns nicht nur an etwas Vergangenes erinnern, sondern dass wir auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken dürfen. Bei allem, was uns besorgt oder bedrängt, wissen wir: Gott wird letzten Endes alles zum Guten wenden für die, die ihn wachend und betend erwarten, wie es Jesus sagt. Schon das Alte Testament ist gefüllt mit dieser Erwartung. Der Prophet Jeremia sagt: Es werden „Tage der Rettung“ kommen. Ihr dürft etwas von Gott erwarten: Rettung, Erlösung, Heil. Der Herr „ist unsere Gerechtigkeit“, hieß es in der Ersten Lesung.
Als Christen ist uns eine gute Frohe Botschaft mitgegeben, aus der wir schöpfen: Gott ist in die Welt gekommen, um sie zu heilen, um uns den Weg zum Leben in Fülle zu zeigen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und der Advent schenkt uns ebenso eine hoffnungsvolle Perspektive für die Zukunft: Jesus wird wiederkommen, alles zu vollenden, um den Armen und Bedrängten zu ihrem Recht zu verhelfen. Nun fehlt uns nur noch ein dritter Blick darauf, was Advent bedeutet, nämlich die Gegenwart.
Wenn Advent „Ankunft“ heißt, dann geht es nicht nur um das Gestern und das Morgen. Es geht um Ankunft des Herrn in meinem Leben hier und heute. Die Adventszeit ist ein großes Geschenk an uns. Wir dürfen uns bereiten, dass der Heiland in meinem Leben ankommen kann. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, das gilt für die Tür meines Herzens. Nutzen wir diese Zeit für das Gebet, für das Hinhören auf das Evangelium, für einen Besuch bei einem einsamen Menschen, für gute Taten, damit der Herr mich wachend und bereit findet, wenn er kommt. Amen.
01.12.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler
Predigt von Pfarrer Daigeler zum Christkönigssonntag B
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, in den ersten Jahrhunderten der Kirche haben Theologen intensiv gerungen, was eine angemessene Ausdrucksweise für den katholischen Glauben sein kann. Daraus entstand unser Glaubensbekenntnis. Die wichtigste Festschreibung geschah auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325, was sich im kommenden Jahr zum 1700. Mal jährt. Im Credo, das wir Sonntag für Sonntag sprechen, sind die wesentlichen Aussagen unseres Glaubens festgeschrieben.
Um noch genauer zu beschreiben, wer Jesus Christus ist, entschied man sich später von „zwei Naturen“ zu sprechen: Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Es soll hier nicht um philosophische Begriffsklärung gehen. Aber die Frage: „Wer ist Jesus Christus?“ ist doch zentral für unser Christsein.
Die Antworten bewegen sich auch heute entlang der Linien wie damals. Für die einen ist Jesus ein besonderer Mensch, besonders weise, liebevoll, besonders vorbildlich… Für die anderen ist er Gott, der in Allwissenheit über allem schwebt und letztlich doch unberührt bleibt von menschlichen Ängsten und Fragen. Das Große am christlichen Glauben ist, dass er die Spannung nicht in die eine oder die andere Richtung auflöst. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, beides in Fülle, ohne dass etwas vom Gottsein oder vom Menschsein fehlen würde.
Das ist wichtig, um das heutige Christkönigsfest recht zu verstehen. Wenn wir die schönen Lieder singen: „Christus König allezeit…“, dann könnte man meinen, es ginge um Triumphalismus oder um eine Art „Weltherrschaft“. Aber das Evangelium ist sehr deutlich. „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, sagt Jesus vor Pilatus.
Jesus bekräftigt seinen Anspruch, König zu sein, und macht gleichzeitig deutlich, dass er nicht in der Weise König ist oder sein will, wie es in unserer Welt erwartet wird. Christus ist Sieger, aber sein Weg dorthin ist keine Schlacht, sondern ist seine Hingabe am Kreuz. Christus ist Herrscher, aber sein Weg ist nicht die Unterdrückung anderer Völker, sondern ist die Gotteskindschaft, die er mit uns teilen will. Durch sein Blut hat er uns „zu seinem Königreich gemacht“, hieß es in der Zweiten Lesung.
Das scheint mir wichtig für unsere heutige Situation als Kirche. Gar nicht wenige Christen leiden darunter, dass die Beteiligung rückläufig ist. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass meine Nachbarn ebenso wie ich am Sonntag zur Messe gehen. Ganz im Gegenteil. Auch das öffentliche Ansehen unserer Kirche ist oftmals beschädigt… Ich will das weder relativieren, noch lässt es mich unberührt. Aber ich frage mich immer mehr: Entspricht unsere Auffassung von der Kirche dem, was wir von Christus bekennen? Und das muss ja zusammenhängen, schließlich ist es ja seine Kirche, seine Stiftung.
Darum ist die Kirche ganz menschlich. Das heißt, ihre Formen und Strukturen sind den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt unterworfen, dem Werden und Vergehen. Kein Gebäude, kein Verband ist für die Ewigkeit bestimmt. Darum gibt es in der Kirchengeschichte Hochzeiten mit großem Zuspruch und Aufbruch und es gibt auch tiefe Täler, in denen manches abgebrochen wird. Diese Stunden des Kreuzes sind hart für alle, die sie ertragen müssen. Gleichzeitig ist die Kirche ganz göttlichen Ursprungs. Jesus hat sie gestiftet und gewollt. Darum brauchen wir keine Angst um ihre Zukunft zu haben. Der Herr verlässt die Seinen nicht. Wer Christus zum König gewählt hat, braucht sich nicht mehr zu fürchten vor den Mächten dieser Welt, vor dem Wandel der Zeit mit ihrem Auf und Ab. Der Prophet Daniel sagt es deutlich: „Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.“
Das Christkönigsfest ist von großem Realismus geprägt. Wir hören bewusst ein Evangelium aus der Passion. Unser König trägt eine Dornenkrone. Er teilt unsere Nöte und Kämpfe. Gleichzeitig ist das Christkönigsfest von einem unerschütterlichen Trost geprägt. Christus ist Sieger und König. Er ist auferstanden. Er hat das letzte Wort – nicht die lauten und gerissenen Meinungsmacher. Hören wir auf seine Stimme, dann brauchen wir keine Furcht zu haben. Denn er sagt: Habt Vertrauen, „ich habe die Welt besiegt“! Amen.
24.11.2024, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler